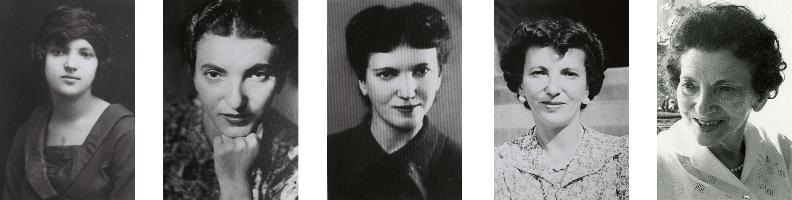Texte zu Rose Ausländer
Texte zu Rose Ausländer
Alex Burkhard
Alex Burkhard war Münchner, bayrischer und deutschsprachiger Poetry Slam Meister
Und hat für seine Texte Stipendien und Preise erhalten. Er ist Initiator zahlreicher Live-
Literatur-Formate, aktuell mit der Leseshow „Abend mit Goldrand“ im zaak in Düsseldorf. Er
gibt Workshops zu kreativem Schreiben und Storytelling, im Satyr Verlag Berlin erschienen
vier Bücher. Für das Goethe Institut performte er in Portugal, Zypern und Mexiko.
Rose Ausländer: Eine leere Wohnung
Originalversion 2023-04-17
Im Oktober 1972 mietet Rose Ausländer eine Sozialwohnung in der Mönchenwerther Str. 23 an. In der
Wohnung befinden sich acht Koffer.
Im ersten Koffer: die Heimat
Grüne Mutter
Bukowina
Schmetterlinge im Haar
Trink
sagt die Sonne
rote Melonenmilch
weiße Kukuruzmilch
Rosalie Scherzer wurde 1901 in Czernowitz geboren, Hauptstadt der Bukowina, Herzogtum Österreich-
Ungarns. In ihrer Kindheit war die Stadt ein multiethnisches kulturelles Zentrum, Rosalie mittendrin,
doch während des Ersten Weltkriegs musste die Familie nach Wien fliehen. Als sie 1919 zurückkehrt
gehört die Stadt zu Rumänien. Ein Jahr später stirbt Rosalies Vater, ihre Mutter drängt sie in finanziellen
Nöten zur Ausreise,
die Verletzung atlantiktief
studiumsabbruchtief
entwurzelungstief.
Denn wo ist Heimat? Keiner weiß Bescheid.
Wo Schwalben nisten, sind wir nicht allein.
Im zweiten Koffer: die Liebe
Wir werden uns wiederfinden
im See
du als Wasser
ich als Lotusblume
Du wirst mich tragen
ich werde dich trinken
Wir werden uns angehören
vor allen Augen
In die USA begleitete Rosalie ihr Jugendfreund Ignaz Ausländer, dessen Namen sie nach der Hochzeit
annimmt. Das Gedicht schrieb sie jedoch für Helios Hecht, den sie 1926 kennenlernte, für den sie sich
scheiden ließ, mit dem sie in New York, Czernowitz und Bukarest lebte. Und der nach acht gemeinsamen
Jahren ohne ihr Einverständnis unfertige Gedichte und Handschriften veröffentlichte und aus ihnen eine
„Charakteranalyse Rose Ausländer“ ableitete. Sie trennte sich sofort und absolut von ihm, in seiner Studie
stand das nicht. Bis zum Ende schrieb sie ihm Gedichte.
Sogar die Sterne
werden sich wundern:
hier haben sich zwei
zurückverwandelt
in ihren Traum
der sie erwählte.
Im dritten Koffer: die Shoah
Vier Wochen nach Beginn des Zweiten Weltkriegs reiste Rose Ausländer aus der Sicherheit New Yorks
nach Czernowitz – ihre Mutter hatte sie um Pflege gebeten. Im selben Jahr war ihr erster Gedichtband
„Der Regenbogen“ erschienen, in Deutschland wurde das Buch einer Jüdin nicht mehr zur Kenntnis
genommen.
1940 besetzten sowjetische Truppen Czernowitz, sie wurde wegen Spionageverdachts verhaftet. 1941
besetzten mit Deutschland verbündete rumänische Truppen Czernowitz, ein Ghetto wurde eingerichtet.
Das Haus, in dem sie mit ihrer Mutter lebte, befand sich mitten darin. Immer wieder wurden Verwandte
und Bekannte verschleppt und getötet, über Jahre musste Rose Ausländer um ihr Leben fürchten.
Wenn der Tisch nach Brot duftet
Erdbeeren der Wein Kristall
denkt an den Raum aus Rauch
Rauch ohne Gestalt
Noch nicht abgestreift
das Ghettokleid
sitzen wir um den duftenden Tisch
verwundert
daß wir hier sitzen
Im vierten Koffer: das Exil
Ein Tag im Exil
Haus ohne Türen und Fenster
Auf weißer Tafel
Mit Kohle verzeichnet
Die Zeit
Im Kasten
Die sterblichen Masken
Adam
Abraham
Ahasver
Wer kennt alle Namen
Die UdSSR annektierten Czernowitz, die Bevölkerung durfte ausreisen, über Bukarest landete Rose
Ausländer wieder in New York, wo sie fast zwanzig Jahre lebte. Sie verließ jedoch kaum ihr Viertel,
pendelte zwischen ihrer Arbeitsstelle als Fremdsprachenkorrespondentin und ihrer Wohnung. Sie wurde
nie heimisch, wohnte möbliert oder bei Freunden, ihre Koffer stets gepackt, von der Heimat träumend –
die für sie, manifestiert auch durch den Tod der Mutter 1947, nicht mehr existierte.
Ein Tag im Exil
Wo die Stunden sich bücken
Um aus dem Keller
Ins Zimmer zu kommen
Schatten versammelt
Ums Öllicht in ewigen Lämpchen
erzählen ihre Geschichten
Mit zehn finstern Fingern
Die Wände entlang
Im fünften Koffer: die Sprache
Mein Vaterland ist tot
sie haben es begraben
im Feuer
Ich lebe
In meinem Mutterland
Wort
Rose Ausländers Sprache war klar und ungekünstelt, ihre magische Schlichtheit lässt ihrer Wirkung
Raum. Sie selbst schrieb an eine Freundin, ihre Verse seien „Fragen ans Leben (Erde) und der Wunsch
(die Bitte) nach etwas Stabilem, Immanentem im erschreckenden Dahinströmen,
Hinweggeströmtwerden“.
In New York schrieb sie Englisch, bevor die Dichterin Marianne Moore sie 1956 ermutigte, wieder auf
Deutsch zu dichten, weil die besten Gedichte nur in der Muttersprache entstünden. Ein Jahr später
begegnete sie Paul Celan, der sie mit der Deutschen Moderne bekannt machte.
Die alte Sprache
kehrte jung zurück
Unser verwundetes
geheiltes
Deutsch
Im sechsten Koffer: die Unrast
Ich war einmal anders
sagst du dem Spiegel
er glaubt es dir nicht.
Im Dezember 1961 wurde Rose Ausländer krankheitsbedingt Rentnerin. Sie sehnte sich nach dem
deutschen Sprach- und Kulturraum, siedelte erst nach Wien über, 1965 nach Düsseldorf, kurz darauf
erschien ihr zweiter Gedichtband „Blinder Sommer“, 26 Jahre nach dem ersten. 1967 erhielt sie einen
renommierten Lyrik-Preis, ihre Gedichte wurden in Zeitungen abgedruckt und im Radio gelesen.
Bis 1972 war sie konstant auf Reisen: Lesungen, Kongresse, Bildungsreisen, Kuraufenthalte. Kleine
Glücksmomente wechselten sich ab mit körperlicher Auszehrung, die Hektik des Nomadenlebens machte
ihr zu schaffen. „Jede Reise endet mit Krankheit und Erschöpfung“, schrieb sie der Freundin, trotzdem
plante sie immer neue Besuche und Aufenthalte.
Mit meinem Seidenkoffer
reise ich in die Welt
Im siebten Koffer: das Jetzt
Kommen Menschen
mit vielfarbnen Fragen
Geht zu Sokrates
antworte ich
Die Vergangenheit hat mich gedichtet
ich habe
die Zukunft geerbt
Mein Atem heißt
jetzt
Ich sitze im ICE nach Düsseldorf, als ich den Briefwechsel Rose Ausländers mit ihrer Freundin Ursula
Ratjen lese. Nach Hunderten Gedichten, nach Biografien, Artikeln und Nachrufen berühren mich diese
Briefe am Meisten, vielleicht weil sie nicht bis zu fünfundzwanzig Mal überarbeitet sind. In Echtzeit
bekomme ich die Phase Anfang der Siebziger mit, als ihr Körper sagt: genug. Ihre Seele sich öffnet und
sich das Erlebte aus sieben Jahrzehnten Bahn bricht.
Im Oktober 1972 mietet Rose Ausländer eine Sozialwohnung in der Mönchenwerther Str. 23 an. In der
Wohnung befinden sich acht Koffer. Freunde haben sie in die Wohnung getragen. Sie selbst liegt nach
einem Unfall in der Klinik, von dort wird sie auf der Pflegestation des Nelly-Sachs-Hauses, dem
Elternhaus der jüdischen Gemeinde, aufgenommen. Ende 1973 tragen ihre Freunde die Koffer aus der
Wohnung. Rose Ausländer hat sie nie betreten.
Im Nachwort zum Briefwechsel schreibt Helmut Braun: „Rose Ausländer hat nicht in Düsseldorf gelebt.“
Was jetzt ein bisschen blöd ist, weil ich sie als Düsseldorfer Autorin vorstellen wollte. Und die Fakten
sprechen für mich: Sie war 22 Jahre lang hier gemeldet und hat den größten Teil ihres Werks hier verfasst.
Doch die Stadt kommt, anders als andere Wohnorte oder Reisestationen, nicht in ihren 2.500 Gedichten
vor; sie wollte von Beginn an wieder weg, hat sich konkret für eine Wohnung in München beworben;
wenn sie hier war, dann auf Durchreise, mit neuen Plänen zum Aufbruch. Die Entscheidung für
Düsseldorf war aus Pragmatismus gefallen: hier lebten einige Menschen aus Czernowitz.
Die Entscheidung für Düsseldorf ist aus Pragmatismus gefallen: hier lebte meine Freundin. Ich zog in die
Stadt in der Annahme, dass ich hier nicht ewig bleiben würde. Während ich den Transporter
beeindruckend sicher rückwärts in die enge Einfahrt bugsierte, träumte ich von einem Haus im Grünen.
Während ich meine acht Koffer in unsere Wohnung trug, liebäugelte ich mit Jahren im Ausland. Während
ich die Küche einbaute, überschlug ich ihren Wiederverkaufswert. Die Charakteranalyse Alex Burkhard
fällt nicht vorteilhaft für mich aus.
Die Auseinandersetzung mit Rose Ausländer ist absolut. Nichts nebenher. Ich schreibe zwanzig Seiten
voll. Noch mal zehn. Noch mal. Lese. Schreibe. Suche. Wo bin ich ihr nah? Im Rastlosen? Ich schäme
mich. Arbeite mich ab an ihr. Arbeite. Leere Wohnung. Isolation. Sie flüchtet, Koffer, ich flüchte.
Verluste? Heimat, Mutter. Schäme mich. Suche. Suche. Im Absoluten finde ich sie. Im
Nichtanderskönnen. Im Einenausgangsuchen. In den Worten. Worte.
Im achten Koffer: das Ende
Wirf deine Angst
in die Luft
Bald
ist deine Zeit um
bald
wächst der Himmel
unter dem Gras
fallen deine Träume
ins Nirgends
Das letzte räumliche Extrem ist ihr Bett. Nach 15 Jahren Verwurzelung und Bindung, fast fünfzig Jahren
des gleichzeitig Ein- und Ausgesperrtseins, nach Jahren der ruhelosen Suche nach dem Verlorenen,
konzentriert sich nun alles auf knapp zwei Quadratmeter.
Helmut Braun begleitet sie in diesen Jahren. 1975 hat er einen literarischen Verlag gegründet und sie zum
ersten Mal besucht. In kurzer Folge veröffentlicht er zahlreiche Gedichtsammlungen, nach einer
Rezension in der SZ hagelt es Aufmerksamkeit und Preise.
Rose Ausländer ist das alles schön und willkommen, doch der Alltag, das Interesse und der Kontakt
bereiten ihr größte Mühe. Im Dezember 1977 erklärt sie sich selbst für bettlägerig und isoliert sich immer
mehr von ihrer Umwelt; das einzige, das sie noch interessiert, ist ihre Lyrik.
Noch
duftet die Nelke
singt die Drossel
noch darfst du lieben
Worte verschenken
noch bist du da
Sei was du bist
Gib was du hast
Jeden Freitag um 18:45 Uhr kommt Helmut Braun, sie diktiert ihm Gedichte, er bringt ihr abgeschriebene
Versionen mit, die sie umarbeitet, akribisch, wach, stoisch. Ab 1984 ist Braun neben ihrem Bruder und
dem Pflegepersonal der Einzige, der sie noch besuchen darf, sie schreibt und schreibt, bis sie kein
Bedürfnis mehr hat, zu schreiben. Bis alles geschrieben ist. Mit 85 Jahren entsteht ihr letztes Gedicht.
Gib auf
Der Traum
lebt
mein Leben
zu Ende
Rose Ausländer. Acht Koffer. Was für ein Leben.
Gregor Kuntze-Kaufhold
Noch bist Du da
Ich hätte Dich wirklich gerne abgeholt. War leider zu schwach an diesem Tag. Ich meine nicht
die Muskeln. Die waren stark. Auch nicht den Plan, der war gut. Eigentlich. Wäre nicht das
Pech dagewesen. Es war nicht schwarz, dieses Pech. Es war blau. Es troff nicht heiß auf einen
Angreifer, der sich vor das Burgtor wagt. Es stand mit vier Rädern auf einem Parkplatz. Vor
dem Frachtflughafen. Hatte die Gestalt eines VW Kombi. Ich erkannte es nicht. Wusste nicht,
was das bedeutete. Hatte keine Ahnung, dass der meistgefürchtete Zollbeamte mit seiner
gehassten Spätschicht begonnen hatte.
Er saß im Gebäude wie eine zu dicke Gottesanbeterin und wartete auf die Beute, die ihm
sein Tag bringen sollte. Die Beute war ich.
Wirf Deine Angst in die Luft
„Was bringen Sie mir da Schönes?“ Ich dachte nach. Hatte ich die Zollbeamtin schon einmal
gesehen? Sie strahlte. Es galt nicht mir. Oder besser gesagt: Nicht mir als Person, erst Recht
nicht mir als Mann, und schon gar nicht mir als jemandem, der seiner Verpflichtung
nachkam, ein Gut zu verzollen. Aus ihren nussbraunen Augen funkelte die Lebensfreude. Sie
mochte Ende Zwanzig sein. Ihre blonden, glatten Haare hielt ein schmuckloses Bändchen
hinterm Kopf so eng zusammen, dass ihr Gesicht, das zur ovalen Form neigte, etwas
Schablonenhaftes bekam. Mit ihrer Uniform verhielt es sich umgekehrt. Obwohl sie
vorschriftsmäßig gekleidet war, in langer blauer Hose und kurzärmeligem Hemd, auf dessen
Rückseite in Großbuchstaben „ZOLL“ prangte, ging nichts Uniformes von ihr aus. Woran
mochte das liegen? Ihre Nase war lang, aber schlank, und wirkte seltsam fleischlos, als ob sie
nicht zu einem Sinnesorgan gehörte, sondern dafür da wäre, zwischen Mund und Auge zu
vermitteln. Auch ihr Mund kam mir, als sie lachte und ihre weißen, regelmäßigen Zähne
zeigte, merkwürdig unsinnlich vor. Ob es an der dicken Fensterscheibe lag, die sich zwischen
uns befand? Umso mehr fing mich ihr Blick ein. Er war neugierig, offen. „Was bringen Sie mir
da Schönes?“ Ihre Frage schien nach etwas Fremdem zu verlangen. Wie ein Gruß, der in
weiter Ferne schwingt. „Eine Büste!“ sagte ich, und schob nach: „Eine Porträt-Büste bringe
ich Ihnen. Von Rose Ausländer.“ Ich erwartete den Ausdruck eines Erstaunens. Sei es der
Freude, die Eingeweihte überfällt, wenn sie sich an einem Zeichen erkennen, das sie
verbindet. Sei es – was wahrscheinlicher war – der Neugier. Sie wollte vielleicht mehr
erfahren. Ich stellte mir vor, wie ich ihr erzählen würde, dass Düsseldorf zweimal beschenkt
wurde. Erst durch die Dichterin selbst, die den Nordpark zum Blühen brachte. Bis sie starb,
1988. Jetzt durch die Büste, die ebendort aufgestellt werden sollte. 33 Jahre später.
Es kam wirklich zu einem Ausdruck des Erstaunens. Aber nicht in ihrem, sondern in meinem
Gesicht. Nämlich als sie fragte: „Privat oder gewerblich?“ Ich fühlte mich wie in einem
Bewerbungsgespräch. Das war kein gutes Zeichen. Ich hatte mal gepatzt. Woran hatte es
damals gelegen? Während ich noch überlegte, sprudelte aus mir heraus: „Weder noch.“ Das
war eine schlechte Antwort. Das sah ich sofort. Der dickliche Zollbeamte, der an seinem
Schreibtisch gegenüber der jungen Zollbeamtin saß, zuckte. Es war nur der Hauch einer
Bewegung, fast unmerklich. Wie bei einer Gottesanbeterin, durchfuhr es mich. Als wäre sie
ihrer Witterung nicht sicher. Ich musste die Zollbeamtin schnell auf meine Seite ziehen.
Bevor mich der Bannstrahl der Gottesanbeterin traf. Aber wie? Ich tat, als hätte ich den
Zollbeamten nicht gesehen. Dabei beherrschte er mit seinem Blick den ganzen Raum. Nur
ein Idiot konnte diesen Blick übersehen. Oder ein Tagträumer wie ich. Ich konzentrierte mich
voll und ganz auf die junge Zollbeamtin. Buhlte um ihr Interesse: „Es ist ein Geschenk. Die
Büste soll im Nordpark aufgestellt werden. Zum Gedenken an Rose Ausländer. Der Dichterin.“
Und schon machte ich mir selbst wieder Mut. Wer weiß, vielleicht war meine Antwort gar
nicht so dumm? Vielleicht fiel gar kein Zoll an? Es ging ja um ein Kulturgut, das für den
öffentlichen Raum bestimmt war. Warum sollte man Dinge, die allen zugutekommen, mit
Abgaben belasten? Wäre das nicht widersprüchlich? Würde der Staat sich damit nicht selbst
besteuern? Die Zollbeamtin ließ in mir Hoffnung aufkeimen: „Oh, im Nordpark! Das freut
mich sehr. Da geh‘ ich oft joggen.“ Die erste Person, die sich über das Geschenk freute!
Meine Laune stieg. Die Einfuhr der Büste war auf einem guten Weg. Dachte ich. Und
täuschte mich gründlich. Vom Zoll war ein anderer Weg vorgesehen.
Die Zollbeamtin wies in mir: „Haben Sie schon das Einfuhrprotokoll?“ Ich schluckte: „Nein, ich
wurde direkt zu Ihnen geschickt. Wegen des Stempels. Ich dachte, Sie könnten mir
weiterhelfen. Den brauche ich, um die Büste abzuholen.“ Schüchtern fügte ich hinzu: „Wieso
muss ich dafür jemanden beauftragen?“ Mir dämmerte eine Anti-Odyssee: Einer, der nicht
listig genug ist, um als Held durchzugehen, wird auf eine Tour ohne Ende geschickt. Auf dem
Weg besiegt er nichts und niemanden. Genauso kam es auch.
Bald
ist deine Zeit um
bald
wächst der Himmel
unter dem Gras
fallen deine Träume
ins Nirgends
Erst später erfuhr ich, warum jeder, der an einem deutschen Frachtflughafen irgendetwas,
das durch den Zoll muss, abholen will, einen Einfuhrspediteur braucht. Der Einfuhrspediteur
fährt die Ernte ein. Digital. Der Zoll muss nur noch die Hand aufhalten. Wieder digital. Analog
ist nur der Idiot, der den Einfuhrspediteur braucht. Ich meine Idiot im Sinn von Einzelnem,
der das System am Laufen hält. Und dabei laufen muss. Warum aber braucht man laufende
Idioten? Ich hatte viel Zeit, mir diese Frage zu stellen. Lief nämlich mehrere Stunden durch
die kerkerähnlichen Gänge und Gebäudeteile. Habe auch eine Antwort gefunden. Doch
davon später.
In den schier endlosen Fluren warteten kryptische Buchstaben in schummrigem Licht auf
ihre Entzifferung. Es gelang mir nicht. Man muss sich den Düsseldorfer Frachtflughafen als
Reptil vorstellen. Eines, das es nicht mehr gäbe, wenn ein Fachkundiger in den letzten 20
Jahren einen Blick darauf geworfen und etwas zu sagen gehabt hätte. Vermutlich war das
niemandem gelungen. Unmengen zu befördernder Frachten versperrten ja den Blick auf das
Gebäude. Bis die Pandemie kam. Das Reptil, das, architekturgeschichtlich gesehen, längst
hätte ausgestorben sein müssen, hatte bis dahin überdauert. Es war vom Artensterben
übersehen worden. Bis ins Frühjahr 2020. Was wollte man von einem Frachtflughafen mehr,
als dass er funktionierte? Die Abholer mussten so oder so kommen. Lounges wurden nicht
benötigt. Nun war das Reptil einsam geworden. Es röchelte. Hinter den schweren,
zweiflügeligen Eisentüren wand es sich, schnaufte und delirierte. Ich stellte mir vor, dass
seine Lungen Flugzeugturbinen waren, die alles und jeden ansaugten, der in ihre Nähe kam.
Habe ich schon gesagt, dass einsame Flure meine Phantasie anregen? Sicherheitshalber
vergrub ich meine Hände in den Hosentaschen. Es klappte. Ich kam an den Eisentüren
vorbei. Fühlte mich, als hätte ich gefährliche Klippen umschifft. Ohne Gefährten. Ohne
Ruhm. Aber immerhin. Endlich fand ich eine Treppe. Sie führte in die oberen Stockwerke des
Nachbargebäudes. Mitten auf der Treppe, im Nirgendwo zwischen zwei Gebäudeteilen,
stand Kirke vor mir. Kirke war der rauchende Angestellte eines Frachtunternehmens. Er
meinte, sie hatten noch Glück gehabt. Es gab keinen Lockdown für die Frachteinfuhr. Aber
traurig war es, wie 90% des Geschäfts wegbrachen. Und es sei immer noch leer im Vergleich
zu früher. Kirke verwandelte nur seine Zigarette zu Asche, und war doch ein Lichtblick. Ich
sah ihn mehrmals, weil er viel rauchte und ich viel lief.
Das Gebäude glich einem Irrgarten. Die Beschilderung war ein Vexierspiel. Ich hatte darauf
vertraut, dass alles gut organisiert sein würde. Für die Abholung hatte ich eine Stunde
veranschlagt. Das war illusorisch. Schon jetzt. Meinen Besuch im Gerhart-Hauptmann-Haus
würde ich verschieben müssen. Ich hatte ihn ein paar Tage vorher angekündigt. Die Büste
wurde dort erwartet. Sie musste vor ihrer Aufstellung provisorisch eingelagert werden.
Gerhart Hauptmann hatte Rose Ausländer ein Obdach gewährt. In seinem Haus! Bildete ich
mir ein. Es war eine schöne Einbildung. Als hätten die Beiden eine Verabredung. Eine airbnb-
Einladung, einfach, unkompliziert.
Die Träumerei hatte mich abgelenkt. Von Anfang an. So sehr, dass ich auf die Abholung der
Büste miserabel vorbereitet war. Meine Gedanken hatten zu lange um die Begrüßungsrede
gekreist. Längst hätte ich darüber nachdenken sollen, welche Waffen im Überlebenskampf
nützlich wären. Ich tat es nicht. Wusste nicht, dass ich eine Fliege geworden war, der man
einen Flügel ausgerissen hatte. Es war ein Experiment. Die einflügelige Fliege sollte sich in
einer lebensfeindlichen Umgebung behaupten. Man würde sehen, wie lange. Und ob sie sich
beim Einfuhrspediteur neue Flügel würde besorgen können.
Endlich fand ich den Zugang ins angrenzende Gebäude. Es glich aufs Haar dem ersten.
Ebenso verlassen. Genauso laborähnlich. Ob es an der Nachmittagszeit lag? Oder an den
Auswirkungen der Pandemie? Nur eines schien klar: Ich war der einzige, der einen
Einfuhrspediteur suchte. Warum bloß? Wo waren die anderen Fliegen? Der Linoleumboden
verschluckte jedes Geräusch von Schritten. War er dazu geschaffen worden?
Am Ende des Gangs traf ich auf schmucklose Bürotüren. Ich klopfte wahllos an eine von ihnen.
Erst geschah nichts. Ich öffnete sie vorsichtig. Zwei Menschen standen im Raum. Sie
reagierten höflich. Nein, sie seien keine Einfuhrspediteure. Wüssten aber, wo man die fände.
Nicht weit entfernt, ein paar Räume weiter. Dort klopfte ich nochmals. Man bat mich herein.
In einem kleinen Büroraum befand sich ein hüfthoher Tresen. Dahinter standen zwei ältere
Herren, die über ihre Computer hinweg ein lebhaftes Gespräch führten. Sie unterbrachen
sich. „Ja, Sie wünschen?“, fragte der ältere von beiden. Er war weißhaarig und sprach
bedächtig. Ich erklärte, die freundliche Beamtin vom Zoll habe mich geschickt, ich solle eine
Anmeldung machen. Es ginge um eine Büste. Ich wollte sie abholen. „Ja, das ist richtig so.“ Er
fragte mich nach den Frachtpapieren. Ich händigte sie ihm aus. Diesmal schien alles zu
klappen. Vielleicht würde sich die Verabredung mit Gerhart noch halten lassen? Der
Einfuhrspediteur wiegte den Kopf hin und her: „Ich muss Ihnen sagen, dass die Anmeldung
70 Euro kostet und rund eine Stunde dauert.“ Ich schluckte. Erstens wegen der Kosten.
Zweitens wegen der Dauer. Drittens, weil eine Erinnerung in mir aufstieg. Dunkel anfangs,
dann deutlicher werdend.
Da war die Reise nach Marokko, die ich als 18-Jähriger unternommen hatte, 1987. Ich war
naiv, aber mutig. Mut gehörte dazu, wenn man mit dem Interrail-Ticket nach Marokko
wollte. Das Interrail-Ticket war eine fabelhafte Sache. Man hatte vier Wochen Zeit, um
Europa mit der Bahn zu bereisen. Vier Wochen waren nicht genug, um die gesamte Strecke
zu schaffen. Also musste man sich entscheiden. Ich hatte mich, gemeinsam mit einem
Schulfreund, für die Südwest-Route entschieden. Die hatte den Vorteil, dass man noch ein
Stück der Welt außerhalb Europas bereisen konnte. Marokko klang märchenhaft. Die Welt
vom Kalifen Storch und vom kleinen Muck. Eigentlich hätten uns die Nachrichten, die wir von
anderen Interrailern erhielten, abschrecken müssen. Marokko galt als gefährlich. Nirgends
werde man öfters ausgeraubt als dort. Wir wollten es wissen. Und was geschah? Wir wurden
ausgeraubt. Aber anders als gedacht.
Wir hatten Tanger schnellstmöglich verlassen. Die Hektik im Hafen hatte uns verängstigt. Ein
Taxi fuhr uns die Küstenwüstenstraße entlang. Bis wir in einem weißgetünchten Dörflein
landeten: Asilah. Der Campingplatz lag direkt am Strand. Asilah war ein Idyll. Wir verloren
unseren Argwohn. Ein Student, der von seiner Cousine in Hamburg oder Frankfurt erzählte,
brachte uns ins Geschäft seines Onkels. Wir wurden mit frischem Tee und Gebäck bewirtet.
Fühlten uns wie Weltenbummler. Der Onkel rollte ein paar Teppiche aus. Die passten nicht
in unsere Rucksäcke. Also zeigte er uns Stoffe aus der Fabrik eines Verwandten. Der
produzierte vor Ort. Beste Qualität. Ein Spezialpreis für uns. Ich kaufte eine Schreithose,
mein Schulfreund Hemd und Hose. Auf dem Rückweg, kurz vor dem Campingplatz, sahen
wir, dass die gleichen Hemden und Hosen in den umliegenden Geschäften hingen. Halb so
teuer. Wir waren hereingelegt worden. Von einem Kaufmann, der uns nicht für voll
genommen hatte. Damals hatte ich mir etwas geschworen. Ich wollte die Neugier behalten.
Aber die Blauäugigkeit ablegen. In Ländern außerhalb Deutschlands ist das gar nicht schwer.
Du lässt durchblicken, dass Du die Geschichten, die aufgetischt werden, durchschaust. Und
schon wirst Du ernstgenommen und darfst mitspielen. Das Spiel hat einfache Regeln. Wenn
alle mitspielen, hat es einen hohen Unterhaltungswert. Es funktioniert weltweit. Außer in
Deutschland.
In Deutschland mag man keine Geschichten, die vom Leben erzählen, wie es ist oder sein
könnte. Lieber füttert man Reptilien mit Fliegen, die DINA-Saurier-Formulare von einem
Gebäude A in ein Gebäude B schleppen. Das ist ein Spiel, das schlecht zu durchschauen ist.
Hat man es verstanden, ist es meistens schon zu Ende. Man erfährt dann, dass man ein Idiot
war. Weil man mitgespielt hat. Wem, außer einem Reptil, macht dieses Spiel Spaß? Ich weiß
es nicht. Habe aber eine Vermutung: Es geht nicht um Spaß. Es geht um das, was übrig
bleibt, wenn die Sehnsucht nach dem Leben verloren gegangen ist. Hinausgetrieben. Was
bleibt, ist die Sehnsucht nach Kontrolle. Kontrolle über das Leben. Das Formular, das von den
einflügeligen Fliegen vom Gebäude A ins Gebäude B geschleppt wird, soll keinen Zweck
erfüllen. Es ist der Zweck. Ein verstümmelter, aber immerhin. Solange die Fliegen schleppen,
können die Spieler an sich glauben. Daran, dass sie die Kontrolle über das Leben haben.
Daran klammern sie sich. Wie konnte ich aus dem falschen Spiel heraus und in das andere,
das richtige, hineinkommen? Gar nicht! Ich musste mitspielen. Notgedrungen. Das war ich
Rose Ausländer schuldig.
Ich schluckte noch einmal und sagte: „Ja, wenn es so sein muss, machen wir das. Einen
anderen Weg gibt es ja wohl nicht.“ Der Einfuhrspediteur nickte und nahm die notwendigen
Angaben auf. Den Namen des Künstlers, der die Replik erstellt hatte. Das Material, den
Ankaufpreis. Den Einführenden mit Anschrift. „Das bringen wir jetzt zur Anmeldung“,
erklärte er mir. Ich könne in ca. einer Dreiviertelstunde wiederkommen. Ich verstand nicht,
weshalb man fast eine Stunde brauchte, um einen Satz von dreißig oder vierzig Zeichen ein
paar Räume weiterzubefördern. Zumal, wenn die Räume digital waren. Schluckte noch
einmal. Dann nutzte ich die Zeit für einen Gang zum Parkplatz.
Mein Fahrrad stand unverändert an der Leitplanke für LKW. Dort hatte ich es angeschlossen.
Fahrradabstellplätze gab es nicht. Wer kommt schon mit einem Fahrrad auf einen
Frachtflughafen? Ein paar Meter weiter stand Kirke und rauchte. Ich fragte ihn, ob er sich mit
der Einfuhrspedition auskannte. Nein, meinte er, das sei ihm zu kompliziert. Das konnte ich
verstehen. Kirke war ein netter Kerl. Er kümmerte sich um Dinge, die er beeinflussen konnte.
Aus allem anderen hielt er sich raus. Zigaretten konnte man beeinflussen. Man brauchte sie
nur zu Ende rauchen, ihrer Bestimmung gemäß. Das Feuer war nie weit entfernt, aber man
konnte sehen, wo es aufhörte. Es war einfach, eine lebensrettende Distanz zu ihm
einzuhalten. Beim Zoll war das anders. Ich hätte mir gewünscht, dass Kirke mich verwandelt.
Leider gelang ihm das nicht. Kein Wunder. Zigaretten schmeckten mir noch nie, und mit
lebensrettenden Distanzen habe ich es auch nicht so. Keine Ahnung, wie ich bislang durchs
Leben gekommen bin. Vielleicht bin ich längst ein Avatar meiner selbst, habe es bloß noch
nicht gemerkt. Wenigstens hat mein Avatar kein Ringelschwänzchen. Er grunzt auch nicht,
das wäre mir aufgefallen. Ich habe also keinen Grund, mich zu beschweren.
Eine halbe Stunde später trat ich – oder mein Avatar – wieder beim Einfuhrspediteur ein. Er
setzte eine geschäftige Miene auf. Die Spedition sei erfolgreich abgewickelt worden. „Das
sind dann 58,82 Euro. Zuzüglich Mehrwertsteuer. Macht 70 Euro.“ Ich schaute ihn an,
zögerte. Dachte an Asilah. Damals hatten wir den Onkel ein zweites Mal besucht, auf der
Rückreise. Wir wollten uns an ihm schadlos halten. Beim ersten Besuch hatte er eine
Einladung ausgesprochen, zu einem landestypischen Essen. Die nahmen wir nun an,
nachträglich. Er war sichtlich verdutzt. Tischte uns aber Couscous und Hühnerbeine auf. Die
Einladung war ein heiliges Versprechen. Er war Orientale und konnte sie nicht
zurücknehmen. Wir nutzten das schamlos aus. Machten ihm sagenhafte Import-Export-
Vorschläge. Er durchschaute unsere Geschichten natürlich, war aber zu höflich, uns die Tür
zu weisen. Damals streiften wir die Haut der Greenhorns ab. Ich streckte mich. „Kann ich
noch irgendetwas für Sie tun?“ Der Einfuhrspediteur holte mich aus meiner Grübelei zurück.
Worum ging es? Hier und jetzt? Nicht um meine Haut. Es ging um Rose Ausländer. Sie hatte
die Shoah überlebt. Hatte einen Ort gesucht, an dem deutsch gesprochen wurde. Um ihre
Stimme nicht zu verlieren. In Wien war es ihr unmöglich gemacht worden. Am Rhein fand sie
ihn. Der Einfuhrspediteur war kein Unmensch. Er hatte gefragt, wer sie war. „Nein, ich
glaube nicht. Vielen Dank.“, antwortete ich ihm. Mochte er selbst lesen.
Noch duftet die Nelke
singt die Drossel
noch darfst du lieben
Worte verschenken
noch bist du da
Beschwingt lief ich ins Zollgebäude zurück. Ich fühlte mich gewappnet. Meine Phantasie
blühte wieder auf. Der alles verschluckende Linoleumboden wurde zu Marmor. Ich flog
durch ein Naturkundemuseum. Würde es bald verlassen. Der Abfertigungsbereich mit seinen
Eisentüren war kein Labor oder Kerker mehr. Er war der Eingang zu einer Bühne, auf der das
Leben spielte. Ich landete. Zog wie ein Gladiator die Eisentür auf. Trat in den Raum, wo der
Stempel auf mich wartete. Vor den Schalter mit der Glasscheibe. Das war ein Fehler. Der
dicke Zollbeamte fertigte gerade eine Afrikanerin ab. Sie hatten zwei Kinder bei sich, eines
schöner geschmückt als das andere. Neben ihr, vor dem Schalter der jungen Zollbeamtin,
stand eine zweite Afrikanerin. Sie hatte ein Kind bei sich. Die junge Zollbeamtin gab mir
freundlich ein Zeichen zum Warten. Ich stellte mich hinter die zweite Afrikanerin. Schwelgte
in Farben und bunten Mustern.
Die Gottesanbeterin sah ich nicht kommen. Sie schoss mit beeindruckender Geschwindigkeit
hinter der Glaswand hervor. Ich verharrte wie gebannt. Hätte sie mich in diesem Augenblick
gepackt, es wäre mit mir vorbeigewesen. Sie aber blieb stehen, untersetzt, massig, mit
glühenden Augen. Vom einen auf den anderen Moment verwandelte sie sich in einen
Löwen. Der Löwe brüllte: „Können Sie nicht lesen? Das sind zu viele hier drin!“ Der Löwe
konnte nicht das Virus meinen. Sein Brüllen musste der Herde gelten. Die war zu groß. Das
Jagen machte ihm Schwierigkeiten. Ich zog mich vorsichtig zurück. Schritt für Schritt. Ließ ihn
nicht aus den Augen. Verließ rückwärts das Abfertigungs-Terrain. Wartete vor den
Eisentüren. Eine halbe Stunde später kam eine der Afrikanerinnen mit zwei Kindern heraus.
Was war mit den anderen geschehen? Ich zog vorsichtig die Tür wieder auf. Die andere
Afrikanerin stand samt Kind am Schalter der jungen Zollbeamtin. Sie sahen unversehrt aus.
Aber es schien Probleme zu geben. Ein neuerlicher Rückzug war angebracht. Ich wollte den
Schalter der Zollbeamtin nutzen, sobald er frei würde. Aber es war zu spät. Der Zollbeamte
war in sein Gottesanbeterinnen-Kleid zurückgeschlüpft. Winkte mich zu sich. Ich musste ihn
anblicken. Kurz nur. Da war ich schon gebannt. Die Gottesanbeterin zog mich mit ihrem Blick
magisch zu sich an den Schalter. Ich gab ihr das Einfuhrbeförderungspapier, das mir der
Spediteur gegeben hatte. Den Sinn dieser Prozedur verstand ich immer noch nicht. Das stand
mir allzu deutlich auf der Stirn. Die Gottesanbeterin las meine Gedanken. „Da hat der
Spediteur Murks gemacht! Es fehlt die Angabe zum Material. So kann ich das nicht
bearbeiten.“ „Es ist eine Bronze-Büste. Vielleicht tragen Sie das einfach ein?“ Meine Renitenz
machte den Zollbeamten wieder zum Löwen. Zack. Er brüllte: „So geht das nicht! Das sind
Ihre Angaben. Die müssen stimmen!“ Die Situation wurde brenzlig. Ich versuchte es mit
Besänftigung: „Sagen Sie mir bitte, was Sie brauchen, ich bestätige Ihnen das.“ Der Löwe
richtete sich auf. Fauchte: „Ich sage Ihnen gar nichts! Dafür haben Sie Ihren Spediteur!“
Plötzlich verstand ich das Spiel. Der Zollbeamte wollte mich nicht fressen. Er wollte mich
mürbe machen. Ich hätte ihn fragen wollen: „Schmecken Ihre Opfer besser, wenn sie sich die
Beine abgelaufen haben?“, dachte aber wieder an Rose Ausländer. Ich war ihre Geisel. Eine
absurde Vorstellung, ich weiß. Aber so sind meine Gedanken manchmal. Vor wie vielen
brüllenden Löwen mag sie gestanden haben? Wie war sie an ihren Popovic-Ausweis
gekommen? Der hatte ihr das Leben gerettet. Damals, im Ghetto von Czernowitz. Und ich
sollte heute den Einzug ihrer Büste durch gekränkte Eitelkeit gefährden? Nein, ich hatte
keine Wahl. Wortlos nahm ich die Beförderungspapiere an mich und ging zum
Einfuhrspediteur zurück. Ich fand ihn nach längerem Suchen wieder. Er wusste Bescheid. Die
Gottesanbeterin hatte ihn informiert. Die Büste hatte eine falsche Nummer bekommen. So
konnte sie nicht verarbeitet werden. „Ich verstehe, dass man hierzulande eine Nummer
braucht, um eine Einfuhr zu befördern“, sagte ich. „Aber warum muss man dafür durch ein
Labyrinth laufen?“ Dem Einfuhrspediteur schien das Ganze peinlich zu sein. Das wunderte
mich nicht. Ich hatte ihn dafür bezahlt, dass er mir half. Er sollte die Einfuhr der Büste
befördern. Die Reptilien und Gliederfüßer im Frachtflughafen fraßen nun einmal gerne
Nummern. Und warum auch nicht? Es war doch gut, dass die Nummern in Computern
eingespeichert wurden und nicht in Arme eingraviert. Allzu schwer konnte es nicht sein, die
falsche Nummer durch die richtige zu ersetzen. Sie war ja digital. Man musste nichts
ausradieren oder auslöschen. Nur eine gespeicherte Information austauschen. Das war viel
einfacher, als eine tätowierte Nummer abzuändern. Etwas arbeitete in dem
Einfuhrspediteur. Ich weiß nicht, welche Gedanken er sich machte. Vielleicht dachte er an
Rose Ausländers Ehenamen? Das Fremdsein, das die Dichterin mit sich trug, ragte in den
Raum hinein. Unsere Gedanken mussten sich an irgendeiner Stelle gekreuzt haben. Er
wechselte abrupt den Tonfall: „Können Sie nicht morgen wiederkommen?“ Ich glaubte, mich
verhört zu haben. „Wieso?“ „Weil Sie Pech haben. Sie haben es mit einem Beamten zu tun,
der im gesamten Frachtflughafen für seine Schikanen bekannt ist.“ Er sprach offenbar von
der Gottesanbeterin. „Wenn wir den blauen Passat auf dem Parkplatz sehen, ist der Tag für
uns gelaufen.“
Die Gottesanbeterin war also in einer blauen Kutsche angereist. Sie schien sich sicher zu
fühlen. Was mochte sie in der Nachtschicht anstellen? Hielt sie in den Hallen des
Frachtflughafens Tribunale gegen alles Fremde ab? Ich konnte mir das gut vorstellen: „Nein!
Nichts kommt rein! Kein malariaverseuchtes Obst aus Afrika! Keine Terroristen-Dattel aus der
Türkei!“ Es war klar – Rose Ausländer hätte keine Chance. Ich blieb hart: „Nein, es tut mir
leid, ich möchte nicht wiederkommen, bis jemand mit der richtigen Kutsche anreist oder das
passende Kleid anhat. Ich hätte gerne heute noch die Bestätigung, dass der deutsche Zoll
nichts gegen Rose Ausländer hat. Ich meine gegen die Einfuhr ihrer Büste.“ Der
Einfuhrspediteur seufzte. Er korrigierte die Nummer. Schickte mich mit einem Ausdruck des
Bedauerns zurück zur Gottesanbeterin. Vermutlich rechnete er nicht damit, dass ich
überlebte. Aber ich wusste inzwischen, dass der Zollbeamte größeren Gefallen daran hatte,
die Folterwerkzeuge zu zeigen als seiner Beute den Garaus zu machen. Tatsächlich reagierte
er lakonisch: „Da müssen Sie nochmal zurück!“ „Wieso?“ „Das muss ich Ihnen nicht sagen.“
„Vielleicht dürfen Sie es aber?“ Erst hier tauschte er die Fangbeine wieder gegen eine
Löwenmähne. Der Löwe brüllte: „Ich bin nicht dafür da, Ihnen irgendetwas zu erklären!“ Aus
der Sicht des Löwen stimmte das. Die Machtfrage war längst geklärt. Es gab keinen Grund,
sie mir nochmal auseinanderzusetzen. Ich sah die Sache mittlerweile in einem anderen Licht.
Wohin fuhr die Gottesanbeterin mit ihrem blauen Kombi, wenn sie den Frachtflughafen
verließ? Hatte sie ein Zuhause, in dem die Machtfrage genauso ein für allemal geklärt war,
nur andersherum? Wurde der Löwe vor dem Sofa zum Mäuschen? Und konnten die Zangen,
die jetzt nervös zuckten, am Ende gar nicht zupacken? Ich beäugte das Mischwesen
intensiver. Es verfärbte sich. Ich sagte ihm, ich ginge ein letztes Mal zum Einfuhrspediteur,
danach nicht mehr. Was dann geschehen würde, ließ ich offen. So ähnlich muss es früher zu
Duellen gekommen sein. Der Scharfschütze provoziert, bis ein Gernegroß anbeißt und im
Morgengrauen ins Gras beißt. Würde es zwischen uns so weit kommen? Hatte ich eine
Chance? Ich wusste es nicht. Der Einfuhrspediteur schüttelte den Kopf, als ich ihn endlich
wieder fand. „Jetzt hat er uns auf dem Kieker.“ „Wieso uns? Mich!“ „Ja, aber der macht da
keinen Unterschied. Alle, die mit ihm zu tun haben, werden abgekanzelt. Wir auch.“
Wer hielt den Faden dieses Labyrinths in der Hand? War die digitale Einfuhrkontrolle wirklich
nur das Mittel, das es dem Zollbeamten erlaubte, ins Kostüm des Tiers, das in ihm steckte, zu
schlüpfen? Immerhin war es dem Einfuhrspediteur gelungen, mit der Gottesanbeterin zu
telefonieren. Es hörte sich an, als könne eine weitere Unstimmigkeit ausgeräumt werden. Ich
glaubte an eine Täuschung. Auch noch, als der Einfuhrspediteur mich wieder zurückschickte.
Ein letztes Mal in die Fänge der Gottesanbeterin. Diesmal war ich die einzige Fliege im
Abfertigungsbereich. Die Gottesanbeterin hatte sich wieder an ihren Tisch zurückgezogen.
Saß genauso da, wie sie anfangs gesessen hatte. Die junge Zollbeamtin trat vor. Sie tat, als
ob nichts gewesen sei: „Na, haben Sie alles bekommen?“ „Tja, wenn man das so genau
wüsste“, erwiderte ich zaghaft. „Das sieht aber gut aus diesmal“, versuchte sie zu
beschwichtigen. Dann sprach sie die Gottesanbeterin direkt an: „Kann das sein mit der
Umsatzsteuer? Das kommt mir viel vor.“ Auf den Kaufpreis der Büste hätten 19%
Umsatzsteuer gezahlt werden sollen. Die Gottesanbeterin riss ihren Kopf herum. Ihre Fänge
zuckten nervös: „Das ist doch wieder falsch. Da gehören 7% drauf, weil das ermäßigt ist.“ Ich
rechnete mit dem Schlimmsten. Rücktransport der Büste nach Czernowitz und Neu-
Ausstellung einer Rechnung. Zum Beispiel. Es kam aber anders. Die Gottesanbeterin
korrigierte den Antrag. Tat, was sie vorher nicht tun konnte. Zur jungen Zollbeamtin zischte
sie, dass das teuer geworden wäre. Die nahm den Ball auf und sagte mit einem Lächeln:
„Sehen Sie, es ist doch gut, dass wir das noch einmal überprüft haben. Jetzt haben Sie noch
Geld gespart.“
Ich musste wieder an Asilah denken. Dort hatte die Arbeitsteilung gut funktioniert. Der junge
Bursche war Zuträger, köderte die Touristen. Sein Onkel machte das Geschäft. Worin
bestand der Trick auf der Gottesanbeterinnen-Wiese? Die junge Zollbeamtin entwaffnete die
Ankömmlinge. Waren sie schutzlos und entblößt, fraß die Gottesanbeterin sie auf. Ich zahlte,
315,17 Euro. Ohne weiteres Nachfragen. Nahm die gestempelten Papiere an mich. Zum
Abschied sagte ich zur jungen Zollbeamtin: „Behalten Sie bitte Ihr Lächeln. Das ist bestimmt
nicht einfach. In dieser Umgebung.“ „Wie meinen Sie das?“ „Das Gebäude hätte einen neuen
Anstrich nötig.“ Sie lächelte erleichtert: „Da sagen Sie was. Das stimmt, es ist manchmal
bedrückend, wenn man in so ein Gebäude muss.“ „Das glaube ich Ihnen. Ich drücke Ihnen die
Daumen. Es wäre unheimlich schade, wenn Sie Ihr Lachen verlieren würden.“ Viel lieber hätte
ich ihr die letzten beiden Zeilen des Gedichts von Rose Ausländer vorgetragen. Vielleicht tut
es jemand bald, im Nordpark?
Sei was du bist
Gib was du hast.
Und die Büste? Der Ausgabeschalter war geschlossen. Ich musste Rose Ausländer im Bauch
des Reptils zurücklassen. Noch eine volle Woche lang. Dann erst konnte ich sie abholen. Es
war kein blauer Kombi auf dem Parkplatz zu sehen. Ein gutes Zeichen. Ich ließ das Linoleum-
Labyrinth rechts liegen. Ging mit dem gestempelten, DINA-Saurier-Frachtpapier direkt zum
Ausgabeschalter. Von dort hatte man mich vor einer Woche in den Kerker geschickt. Der
blieb mir dieses Mal erspart. Obwohl nicht alles stimmte. Die Gottesanbeterin hatte das
falsche Kästchen angekreuzt. Oder war es die junge Zollbeamtin gewesen? Ich konnte mich
nicht erinnern, wer von den beiden das Papier unterschrieben hatte. Die Unterschrift war
unleserlich. Dem Ausgabespediteur war es egal. Hauptsache, das Papier wies den Stempel
auf. Dem Zoll war nichts entrissen worden, das genügte. Er präsentierte mir seine Rechnung
fürs Einlagern, 81,04 Euro. Etwa die Hälfte war ein Zuschlag fürs späte Abholen. Nur kurz
überlegte ich. Gerne hätte ich das Geld aus der Kasse der Zollabfertigung genommen, ließ
den Gedanken aber schnell wieder fallen. Der Ausgabespediteur gab mir einen Wink.
Schickte mich zur Rampe. Kurz darauf kam ein Gabelstapler aus dem Lager. Er war beladen
mit einer Holzkiste in der Größe eines Kindersarges. Der Fahrer stellte die Kiste auf das
Rollbrett, das ich mitgebracht hatte. Er überließ mir die Holzkiste, nachdem ich ihm das
Frachtpapier ausgehändigt und er die Nummern verglichen hatte. Die Nummern stimmten,
wir durften den Frachtbereich verlassen. Ich schob die Kiste aus dem Gelände hinaus ins
Freie. War stolz. Rose Ausländer wurde erwartet. Gerhart Hauptmann war sicher
ungeduldig. Er würde sich nicht mehr lang gedulden müssen. Wir nahmen die S-Bahn, fuhren
zum Hauptbahnhof. Eine Prozession. Heimlich, aber lautstark. Das lag an den Rollen unter
dem Brett. Sie lärmten. Besonders, als es über das Pflaster des Bahnhofsvorplatzes ging.
Welch ein Kontrast zur Stille des Linoleums! Ich genoss den Lärm und das Treiben der
Menschen. Sie wurden zu Zeugen einer posthumen Dichterbegegnung, ohne es zu merken.
Aber was hieß das schon? Sie hatten Anteil daran, waren ein Teil davon. Darauf kam es an.
Wer weiß? Vielleicht fuhr ein Keltenfürst genau hier einmal rasselnd vorbei. An wem? Wie
hieß er? Wir wissen es nicht. Nur ein rekonstruierter Wagen steht in einem Museum am
Rhein, mit Schellen an den Achsen.
Rose Ausländer war keine Keltenfürstin. Sie kam auch nicht als Dichterfürstin nach
Düsseldorf, damals, 1965. Sie hatte zwei Koffer dabei. Einen aus Stoff.
So konnte sie jederzeit alles Notwendige einpacken, falls eine neue Flucht anstand. Der zweite war in ihrem Kopf. Er
bestand aus Bildern. Die packte sie in den folgenden beiden Jahrzehnten aus. Vorsichtig, Bild
für Bild. Sie würde die Bilder nach und nach in Sprache verwandeln. Jetzt war ihre Büste
angekommen, 56 Jahre später. Eingepackt in eine rollende Kiste. Jemand würde die Büste
auspacken. Ein anderer würde sie im Nordpark aufstellen. Aber das Kind, das mitreiste, was
geschah mit ihm? Ich hoffte, ich hätte es wachgerüttelt. Würde es im Gerhart-Hauptmann-
Haus aus der Kiste steigen und dem Alten in die Haare greifen?
Der Hausmeister wunderte sich, als ich die Kiste lächelnd die kleine Rampe hinauf und ins
Haus hineinschob. Wir rollten sie vorsichtig in einen Nachbarraum, provisorisch.
Adieu, Rose,
und Auf Wiedersehen.